Jahrzehnte nach seiner Vertreibung aus Schlesien kehren wir an den Ort der Kindheit meines Vaters zurück – eine Spurensuche voller Fragen, Erinnerungen, Hoffnungen und dem schmerzvollen Erbe der Vergangenheit.
Hier kannst du die Entwicklung meines neuen Buches direkt mitverfolgen. Auf deine Eindrücke, Fragen und Anregungen freue ich mich. Dies ist das 1. Kapitel. Fortsetzung folgt.
Es ist Samstag, der 19. Juli 2009. Nach einer langen Autofahrt von über 1000 Kilometern erreichen wir Schlesien. Ein halbes Jahr lang fieberte ich diesem Moment entgegen.
Schlesien – bislang war es für mich nur ein Wort, ohne tieferen Bezug, ohne Bedeutung. Heimat meiner Ahnen, von der ich nur wenig wusste. Ich wusste von der Bäckerei meiner Großeltern, davon, dass mein Großvater kurz vor Kriegsende noch eingezogen wurde, meine Großmutter fliehen musste und dass vier Kinder gestorben sind. Doch wie sieht der Ort aus, an dem mein Vater seine Kindheit verbrachte? Was wird uns dort begegnen? Was ist damals passiert? Wie wird es für mich sein, wie für meinem Vater, was wird uns erwarten? Viele Fragen schwirren durch meinen Kopf.
Wir suchen die Ausfahrt Löwen. Doch wie wir später erfahren, existiert sie gar nicht mehr. Stattdessen fahren wir bei Oppeln ab und gelangen in ein Waldgebiet. Rechts von uns liegt Dambrau. Irgendwo hier müsste links eine kleine Straße nach Neuleipe abzweigen. Neuleipe – der Ort, in dem mein Vater geboren wurde.
Mein Vater erinnert sich an die Sonntage seiner Kindheit. Damals lief die Familie jeden Sonntag gemeinsam nach Dambrau zur Kirche. Das waren über fünf Kilometer. Der Weg führte sie von Neuleipe durch den Wald, dann über die Handelsstraße nach Oppeln, und schließlich die letzten Meter bergauf bis zur Kirche im Ort. Es war ein weiter Weg, doch die Kinder freuten sich jedes Mal auf diesen Ausflug, erzählt mein Vater. Meist gingen sie zu Fuß, aber manchmal spannte man auch die Pferde ein.
Doch wo ist die Straße? Vor uns liegen nur zugewachsene Waldwege. Sind wir wirklich auf dem richtigen Weg? Mit einem mulmigen Gefühl fahren wir weiter und biegen bei der nächsten Gelegenheit links ab. Wir durchqueren kleine Ortschaften. Der Himmel ist von grauen Wolken bedeckt, und wir hoffen, dass es trocken bleibt und das Wetter uns gnädig ist.
Aufgeregt und voller Erwartung setzen wir die Reise fort. Wir – das sind mein Vater, meine Schwester Ulla und ich. Schon vor Jahren hatten wir unseren Vater gefragt, ob wir gemeinsam seine alte Heimat besuchen sollten. Damals reagierte er zögerlich. „Was sollen wir denn da? Es ist doch alles so lange her. Es ist vorbei.“ Seine Worte klangen endgültig, und wir fragten nicht weiter nach. Vielleicht wollte er einfach nur vergessen und seinen Frieden finden.
Was ist seitdem geschehen? Warum sitzen wir drei jetzt trotzdem im Auto und sind auf dem Weg, die alte Heimat unseres Vaters zu erreichen – jene geliebte Heimat, die er im Alter von nur neun Jahren für immer verlassen musste? Eine Heimat, die nicht nur Erinnerungen birgt, sondern auch den Schmerz eines endgültigen Abschieds.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann für meinen Vater und seine Familie eine Zeit voller Leid und Entbehrungen. Wie Millionen andere Deutsche aus den ehemaligen Ostgebieten wurden auch sie aus ihrer Heimat vertrieben – eine Vertreibung, die sich wie ein Riss durch ihr Leben zog. Die vertrauten Felder, Wälder und Dörfer, die Straßen, die sie kannten, mussten sie zurücklassen. Es gab keinen Raum für Abschiede, keine Zeit, um das Verlorene zu begreifen.
Die Flucht bedeutete kalte Nächte, wenig zu essen, die ständige Angst vor dem Unbekannten und die Qual, alles zurückzulassen, was ihnen einst Sicherheit gab. Für ein Kind wie meinen Vater war es unbegreiflich. Wie erklärt man einem Neunjährigen, dass er nie wieder dorthin zurückkehren wird, wo er geboren wurde? Dass die Orte, die ihm vertraut sind, plötzlich jemand anderem gehören?
Und doch sitzen wir nun hier, Jahrzehnte später, auf dem Weg zurück zu diesen Wurzeln. Die Reise ist mehr als nur eine Fahrt – sie ist eine Spurensuche, eine Begegnung mit der Vergangenheit, die unser Vater so lange zu meiden versucht hat. Vielleicht ist es die Zeit, vielleicht sind es wir Kinder, die ihn ermutigt haben. Oder vielleicht ist es das unausgesprochene Bedürfnis, doch noch einmal zu sehen, was damals verloren ging.

Ein Schlüsselmoment in meinem Leben
Im vergangenen Jahr beschäftigte ich mich intensiv mit dem Thema „Kriegsenkel“. Kriegsenkel sind die Kinder jener, die als Kinder im Zweiten Weltkrieg traumatische Erlebnisse hatten. Als ich zum ersten Mal hörte, dass unverarbeitete Traumata von einer Generation auf die nächste übertragen werden können, wurde ich hellhörig. Und plötzlich fiel der Begriff „Kriegsenkel“ wie ein Schlüsselmoment in mein Leben: Ja, ich bin ein Kriegsenkel – ein Kind eines kriegstraumatisierten Kriegskindes.
Ich war lange auf der Suche nach einer Erklärung für meine Gefühle. In dieser Zeit las ich Bücher wie „Wir Kinder der Kriegskinder“ von Anne-Ev Ustorf und „Kriegskinder – die vergessene Generation“ sowie „Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation“ von Sabine Bode. Sie öffneten mir die Augen. Plötzlich war ich nicht mehr allein mit meinen Empfindungen. Es gab andere, die ähnliche Gedanken und Gefühle hatten, die auch mir bis dahin unverständlich waren.
In den Büchern berichten Kriegskinder von ihrem Erleben im Krieg: Hunger, Flucht, Bomben, Zerstörung, Gewalt und Vertreibung. Viele verloren geliebte Angehörige. Diese Kinder durchlebten extreme Traumata, doch es gab weder Raum noch Zeit für Trauer oder Schmerz – geschweige denn für die Verarbeitung der schrecklichen Erlebnisse. Meist fanden sie keinen Trost bei ihren Eltern, da es ums nackte Überleben ging.
Kriegsenkel schildern in den Büchern, wie diese traumatischen Erfahrungen ihrer Eltern ihr eigenes Leben beeinflussen. Viele fühlen sich heimatlos, haben unerklärliche Krankheitssymptome, sind kinderlos geblieben, fühlen sich innerlich leer oder ausgebrannt. Ihr Leben ist von einem ständigen Gefühl des Mangels und Armutsbewusstseins geprägt. Sie stoßen immer wieder an die gleichen Hürden, können sich nicht von ihren Eltern lösen und fühlen sich auch als Erwachsene für sie verantwortlich. Viele haben nie den Mut gefasst, eine Familie zu gründen, geplagt von Ängsten, die sie sich nicht erklären können. Und immer wieder hörte ich von Kriegsenkeln: „Ich weiß gar nicht, warum es mir schlecht geht, ich habe doch gar keinen Grund dazu.“
Ich konnte es kaum fassen – diese Gedanken waren mir so vertraut. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit. Meine Eltern gaben ihr Bestes, um uns gut zu versorgen. Wir sollten es besser haben als sie. Warum also fühlte ich mich nicht so, wie ich es eigentlich sollte? Warum ging es mir nicht gut, wenn doch alles in Ordnung zu sein schien?
Wie viele aus meiner Generation, hatte auch ich meinen Platz im Leben noch nicht gefunden. Unbeständigkeit prägte mein Leben: ständige Wechsel in Job, Freundschaften und Wohnorten. Mein längstes Arbeitsverhältnis dauerte zwei Jahre, meine längste Partnerschaft ebenfalls zwei Jahre, meine längste Wohnzeit an einem Ort sechs Jahre. Meinen wunderbaren Sohn zog ich alleine groß. Mangelgefühle, Selbstzweifel und Existenzängste bestimmten meinen Alltag. Es fiel mir schwer, mich durch den Tag zu schlagen, ich fühlte mich ausgebrannt, innerlich unruhig und zweifelte manchmal daran, ob ich überhaupt das Recht hatte, glücklich zu sein.
Entscheidungen zu treffen, fiel mir oft schwer. Manchmal schlich sich eine unterschwellige Angst ein, einen Fehler zu begehen. Selbst bei scheinbar unbedeutenden Entscheidungen hatte ich Bedenken, etwas falsch zu machen. Diese legtne sich wie ein Schleier über meine Gedanken und raubte mir jede Klarheit. Es fühlte sich an, als könnte ein einziger falscher Schritt alles ins Chaos stürzen. Die Schwere dieser Verantwortung drückte auf mir, als ob der kleinste Fehler unumkehrbare, katastrophale Folgen hätte, die ich nicht mehr rückgängig machen könnte.
Meine Kindheit war unauffällig, materiell gut versorgt. Es gab keine dramatischen Vorkommnisse. Ich war gut genährt, hatte genug zu spielen, wuchs in einer großen Familie mit fünf Kindern auf. Wir mussten zwar jeden Sonntag in die Kirche, doch ansonsten genossen wir viel Freiheit. Stundenlang konnten wir draußen spielen und uns neue Spiele ausdenken. Die weite Wiese hinter unserem Haus, die alten Weidenbäume am Rand – ich liebte diesen Ort.
Doch etwas belastete mich schwer, etwas, das ich nie benennen konnte. Es lag wie ein Nebel über mir, und ich fand keine Worte dafür. Erst als ich die Bücher las und mehr über die Vererbung von Traumata erfuhr, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Mein Vater hatte als Neunjähriger seine geliebte Heimat verloren. Er erlebte Flucht, Vertreibung und unvorstellbare Gräueltaten: Vergewaltigungen, Schläge, Erschießungen. Doch das Schrecklichste war die Zeit in einem Vernichtungslager und der Tod seiner vier Geschwister. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Krieg verhungerten sie alle. Als einziges Überlebendes von fünf Kindern machte sich seine Mutter mit ihm auf den beschwerlichen Weg in den Westen.
Als ich erfuhr, wie Trauma weitergegeben wird, verstand ich plötzlich, warum mir seine Erlebnisse manchmal so vertraut vorkamen. Warum ich, wenn ich nicht an meine eigenen Gefühle herankam, mich plötzlich in einem Flüchtlingslager wiederfand und die Verzweiflung und Todesangst spürte. An kalten Wintertagen, wenn die Bilder von Flüchtlingstrecks in mir aufstiegen, spürte ich eine tiefe Beklemmung.
Nach der Lektüre der Bücher wollte ich mehr über die Vergangenheit meines Vaters erfahren. Doch seine Erinnerungen fielen ihm schwer, viele Details hatte er vergessen. Manche Geschichten kannte er nur aus Erzählungen seiner Mutter. Doch in mir wuchs der Wunsch, mit ihm in seine alte Heimat zu reisen. Mir war bewusst, dass es ein heikles Thema für ihn sein könnte, aber ich spürte eine unbändige Sehnsucht – ich musste dorthin!
Es war ein tiefes, inneres Verlangen, ein Gefühl der Gewissheit, dass es richtig wäre. Und so brachte ich es an den Weihnachtsfeiertagen 2008 zur Sprache.
„Papa“, sagte ich, „ich möchte mehr über deine Erlebnisse erfahren. Es belastet mich, nicht zu wissen, wo meine Wurzeln liegen. Ich möchte deine Heimat kennenlernen. Kommst du mit?“
Er sah mich mit einem ungläubigen Ausdruck an, als könne er kaum fassen, was er hörte. Für einen Moment sprachen unsere Blicke eine Sprache, die keine Worte je ausdrücken könnten. Und doch wusste ich, was er sagen würde.
„Ja, wenn du hinmöchtest – ich komme mit.“ Seine Stimme zitterte leicht, und in seinen Augen schimmerten Tränen, die mehr verrieten, als er je hätte sagen können.
Fortsetzung folgt
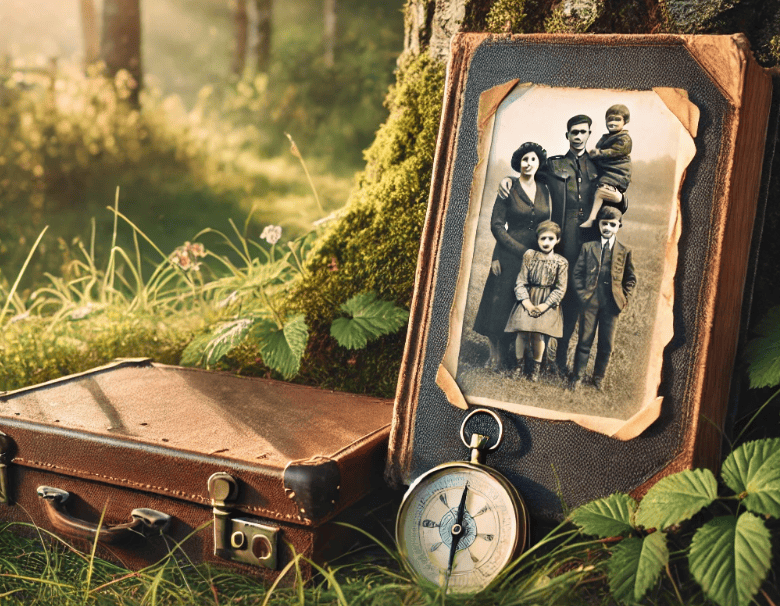
Ja, es ist wunderbar, wenn Eltern sich öffnen können/wollen, weil sie u.U. unbewusst erkennen, dass sie trotz der vergangenen Zeit keine wirkliche Ruhe finden.
Mir war es leider nicht vergönnt, dass meine Eltern diesen Weg gehen konnten – und mir war lange nicht klar, dass und welche Auswirkungen es auf mich und meine Kinder haben könnte/würde.
LG Elke